STEINBORN, GERHARD: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
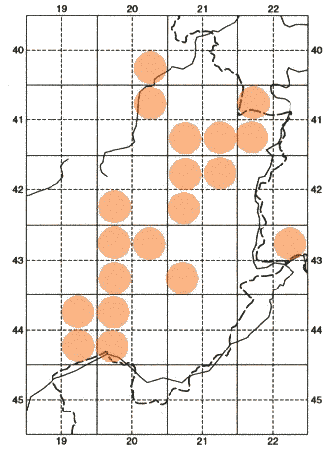 |
|
3. Methode
Aufgrund guter Ortskenntnisse waren mir die meisten Eichenwälder bereits bekannt. Sie wurden kartografisch erfaßt, danach gezielt angefahren und zu Fuß mit der Klangattrappe auf das Vorkommen von Mittelspechten überprüft. Lediglich um in den großen zusammenhängenden Waldgebieten der Egge keine Abteilung mit älteren Eichen zu übersehen, wurde das Staatliche Forstamt Bad Driburg-Neuenheerse aufgesucht. Hier stellte man mir freundlicherweise die Revierkarten zur Einsichtnahme zur Verfügung. Die über 80-jährigen Eichenbestände wurden in eigene Karten übertragen und dann zwecks Überprüfung aufgesucht. Jüngere Bestände wurden nur stichprobenartig untersucht. Da hier nirgends Mittelspechte nachgewiesen werden konnten, wurde von ihrer Kartierung und gründlicherer Untersuchung abgesehen.
Alle Begehungen fanden von Ende März bis in die erste Maidekade statt. Zu dieser Zeit waren fast alle Mittelspechte verpaart und verteidigten ihr Revier heftig. Es war daher nur eine Begehung erforderlich. Lediglich in zwei Revieren, in denen nur jeweils ein Männchen auf die Klangattrappe reagierte, erfolgten zwei Begehungen. Einige Reviere, die nach menschlichem Ermessen besiedelt sein müßten, es aber nicht waren, wurden mehrfach aufgesucht.
Alle Wälder mit Eichen, die älter als 100 Jahre waren und einen Flächenanteil von über 40 % aufwiesen, galten als potentielle Mittelspechthabitate und wurden entsprechend untersucht. Neben wenigen reinen Eichenbeständen waren das in erster Linie Eichen-Buchen-Mischwälder in die gelegentlich auch Fichten eingestreut sein konnten.
CONRADS (1992) nutzte als Klangattrappe ein Tonbandgerät, von dem er nur das Quäken abspielte, da er hierauf die meisten Reaktionen erhielt.
Ich benutzte dagegen einen handelsüblichen tragbaren CD-Player mit Wiederholfunktion und ließ die Mittelspechtrufe der CD Nr.3 der Vogelstimmen Europas von Roché abspielen. Sie enthielten neben dem Quäken noch Balzrufe und zwei Gesangsbeispiele verschiedener Männchen.
Die Revierinhaber antworteten sehr schnell und näherten sich dem Störenfried oft bis auf wenige Meter. Ließ man den Gesang trotzdem noch etwas weiter ertönen, so erschien auch immer das Weibchen zur Unterstützung der Revierverteidigung. Oft kamen aber auch beide Partner gleichzeitig angeflogen. Um weitere Störungen zu vermeiden und das weitere Verhalten zu beobachten, wurde das Gerät dann abgeschaltet. Hinweisen von CONRADS (1992) folgend, begann der nächste Versuch erst mindestens 200 m weiter, um ein Folgen des vorher ermittelten Paares zu vermeiden.
Für Untersuchungen in Wäldern, in denen mehrere Paare vermutet wurden, setzte ich eine zweite Person ein. Sie hatte die Aufgabe, in die entgegengesetzte Richtung zu schauen wie ich, um festzustellen, woher die Tiere kamen und wohin sie flogen (besonders, wenn man sich in der Nähe einer Reviergrenze befand), damit Doppelzählungen ausgeschlossen werden konnten.
Befand sich in Richtung der ersten Reaktionen auf die Klangattrappe Totholz an den Bäumen, wurde dies oft mit Erfolg nach Höhlen abgesucht.
Für jedes besetzte Revier wurden am Ort der Beobachtung Daten über den Baumbestand erfaßt und das Alter geschätzt. Der exakte Flächenanteil der Eichen und ihr genaues Alter sowie Angaben zum Unterstand hätte man in den jeweiligen Revierförstereien erhalten können. Darauf wurde jedoch verzichtet, da viele Waldkomplexe den verschiedensten Privatwaldbesitzern gehörten und eine Recherche nach den einzelnen Besitzern und das jeweilige Aufsuchen vom Aufwand und der Zeit her gesehen in keinem Verhältnis zu den zu erhaltenden Daten stehen. Der Vergleich der verschiedenen besetzten Mittelspechtreviere aus eigener Anschauung, aber auch in der Literatur (z.B. CONRADS 1992) zeigt, daß die Kenntnis dieser Detaildaten keinen großen Wert für die Beurteilung von Mittelspechtrevieren hat. Dem Mittelspecht reicht offenbar ein groberes Muster zur Habitaterkennung aus (siehe Ergebnisse).
4. Das Untersuchungsgebiet
4.1 Landschaftliche Gliederung und Geologie
Der Kreis Höxter im Oberen Weserbergland reicht von Westen nach Osten vom Kamm der Egge bis an die Weser und von Süden nach Norden von der Diemel bis an eine niedrige Schwelle, welche die Steinheimer Börde von dem Blomberger Becken im Lipper Land trennt.
Die Egge ist ein langgestreckter, fast paßloser Nord-Süd verlaufender Schichtkamm mit steilem Abfall nach Osten aus harten Sandsteinen der Unteren Kreide. Die Niederschläge überschreiten 1000 mm im Jahr. Auf dem Eggekamm liegt die Rhein-Weser-Wasserscheide. So wird das gesamte Kreisgebiet durch Emmer, Nethe und Diemel nach Osten zur Weser entwässert.
Das im Osten an die Egge anschließende langgestreckte östliche Eggevorland (Sandebecker, Driburger, Willebadessen-Bonenburger Hügelländer und Rimbecker Platte) ist ein von zahllosen Störungen durchzogenes Schollenmosaik, vorwiegend aus weichen, leicht ausräumbaren Mergeln und Tonsteinen des Keupers, Lias und Oberen Buntsandsteins (Röt), aus denen plattenartige Erhebungen aus härterem Muschelkalk ragen.
Weiter nach Osten schließt sich an das Eggevorland der zentrale Kernraum des Kreises mit fruchtbaren Löß- und Kalkböden an: die Steinheimer Börde im Norden, die Borgentreicher und Warburger Börde im Süden und das Brakeler Bergland (Brakeler Muschelkalkschwelle) zwischen beiden. Die Börden sind mit Löß gefüllte Keupermulden, und das Brakeler Bergland ist ein zum Ostrand hin stark zertaltes Muschelkalkplateau, das steil zum Wesertal abfällt.
Im äußersten Nordosten hat der Kreis Höxter einen schmalen Anteil am leichtwelligen, vorwiegend aus weichen Keupertonen aufgebauten Köterbergland.
Das Wesertal ist im Kreisgebiet mit Terrassenflächen wechselnder Breite zwischen dem Brakeler Bergland im Westen und dem Sollinggewölbe im Osten 150 bis 200 m tief eingesenkt. Das Talprofil ist asymmetrisch: Steil fällt das Brakeler Bergland, zum Teil sogar mit fast senkrechten, kahlen Kalkklippen zum Wesertal ab, während auf der anderen Seite der aus hartem Sandstein des Mittleren Buntsandsteins aufgebaute Solling viel sanfter allmählich ansteigt.
Trotz aller naturäumlicher Unterschiede und Klimaschwankungen wäre die natürliche Pflanzendecke ohne menschliche Eingriffe im ganzen Kreis ziemlich einheitlich und hätte sich in den letzten 2000 Jahren kaum geändert. Fast die ganze Fläche wäre mit Buchenwald bedeckt, der sich nur nach Begleitpflanzen und Beimischungen unterteilen ließe.
Der Mensch hat hier durch Umwandlung von Wald in Acker- und Grünland mehr geändert als das Klima und dadurch auch die geologischen Verhältnisse deutlich herausgearbeitet. Die artenreichen Buchen- und Eichen-Hainbuchenwälder der guten Böden in den Tallagen fielen ihm zuerst zum Opfer. Übrig blieben die artenarmen Perlgras-Buchenwälder, die Hainsimsen-Buchenwälder der noch ärmeren Höhen und die artenreichen Orchideen-Buchenwälder der warmtrockenen Steilhänge westlich der Wesertalung.
Der verbliebene Anteil an Eichenwäldern ist entsprechend gering. Die Grafik unten zeigt die Verschiebungen der prozentualen Anteile der Holzarten im Forst Corvey in den letzten 200 Jahren auf einer Fläche von ca. 3700 ha. Sie gilt stellvertretend für den ganzen Kreis.
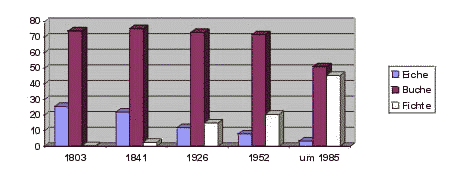 |
|
5. Ergebnisse
Im Rahmen der Mittelspechtkartierung im Kreis Höxter wurden insgesamt ca. 577 ha Eichenwald kontrolliert. Waldflächen mit einzelnen eingestreuten Alteichen und Bestände unter 80 Jahren, die stichprobenartig in den verschiedenen Naturräumen untersucht wurden, sind in dieser Zahl nicht enthalten, da sie keine positiven Ergebnisse brachten. Sie würden lediglich zeigen, daß der Arbeitsaufwand ungleich höher war als die oben genannten 577 ha vermuten lassen, sind jedoch für die Berechnung der Siedlungsdichte ohne Bedeutung und werden daher nicht aufgelistet.
Im Kreis Höxter wurden auf einer Waldfläche von 577 ha 62 Mittelspechtreviere ermittelt. Darin eingeschlossen sind alle vom Mittelspecht besiedelten Bestände sowie einige unbesiedelte, aber potentiell geeignete Flächen mit einer Mindestgröße von 1 ha. Als potentielle Mittelspechthabitate wurden Wälder berücksichtigt, deren Eichen mindestens 100 Jahre alt waren und einen Flächenanteil von mindestens 40 % bildeten.
Eichenalleen mit über 200-jährigen Eichen (Holzhausen, Oldenburg) von nennenswerter linienhafter Ausdehnung blieben unberücksichtigt, da sie zumindest während des Untersuchungszeitraumes nicht besiedelt waren.
Mit berücksichtigt wurden zwei Paare (9 und 10) im Revier E 18 (Eggegebirge), die ca. 20 m und 50 m außerhalb der Kreisgrenze im Kreis Paderborn lagen.
Da der Erhebungszeitraum in die Phase der Paarbildung und des Höhlenbaus fiel, gelangen sehr viele Nachweise von Paaren, die dann als Brutpaar gewertet wurden. In Fällen, in denen genau beobachtet werden konnte, von wo die ersten Reaktionen auf die Klangattrappe erfolgten, wurde gezielt und fast immer mit Erfolg nach der Bruthöhle gesucht. Die wenigen Flächen, in denen nur Nachweise einzelner Männchen gelangen, wurden wie Brutreviere behandelt, da die Männchen durchweg starkes Aggressionsverhalten zur Revierverteidigung zeigten.
Da es sich in der vorliegenden Arbeit aufgrund des engen Zeitrahmens nur um eine reine Bestandserfassung handelt, können Aussagen zur Revierbesiedlung, Fluktuation und zur Brutbiologie nicht vorgenommen werden.
Als Ergebnis der Bestandserfassung des Mittelspechtes im Kreis Höxter läßt sich feststellen, daß die meisten Brutreviere im Eggegebirge zu finden sind. Das ist auch nicht verwunderlich, da hier eine riesige geschlossene Waldfläche vorliegt, die auch die meisten Eichenbestände aufweist. Auffällig ist jedoch die Tatsache, daß bei Untersuchungen in Lippe und im Kreis Paderborn in der Egge keine besetzten Reviere ermittelt wurden. Dieser scheinbare Widerspruch läßt aber leicht klären, wenn man sich die Geologie der Egge betrachtet. Die Höhe nimmt von Westen kontinuierlich bis zum Kamm zu, auf dem die Kreisgrenze verläuft. Da es sich um den ersten Gebirgszug östlich der Münsterschen Bucht handelt, herrschen hier oft rauhe Winde mit ständigen Steigungsregen und einer hohen Zahl von Nebeltagen, Bedingungen, wie sie der Mittelspecht nicht mag. Ganz anders dagegen der Osthang und die Südegge. Hier befindet sich eine sehr steile Abbruchkante mit vorgelagerten Blockhalden, vielen Quellhorizonten und oft alten, nicht leicht zu nutzenden Baumbeständen an der windabgewandten Seite mit geringeren Niederschlägen und höheren Temperaturen. Diese Bedingungen kommen dem Mittelspecht entgegen, und er nutzt sie entsprechend aus.
Das Brakeler Bergland ist nicht sehr dicht besiedelt, was seinen Grund sicher in der isolierten Lage zahlreicher Eichenwälder hat.
Sehr gut besetzt ist der Corveyer Forst (naturräumlich zum Fürstenauer Bergland gehörend). Hier befinden sich die größten zusammenhängenden Eichenbestände mit den ältesten Bäumen. Es scheinen ziemlich alle möglichen Reviere besetzt zu sein.
Die geringsten Vorkommen weist das Wesertal auf, da die Eichenwälder sehr isoliert liegen und nicht immer optimale Strukturen aufweisen.
Gut besetzt ist auch der Steinheimer Wald, der an der Nordgrenze des Kreises inselhaft am Rande der Steinheimer Börde liegt. Er grenzt jedoch an den Schwalenberger Wald, einen der Verbreitungsschwerpunkte des Mittelspechtes im Kreis Lippe.
Die Lage und Ausdehnung der Flächen wurden in die entsprechenden Meßtischblätter (Maßstab 1 : 25000) eingezeichnet und mit einer Gebietsabkürzung und einer entsprechenden Gebietsnummer (z.B. E 1 für das erste Revier in der Egge) gekennzeichnet. Die Mittelspechtreviere wurden mit einer fortlaufenden Nummer versehen und ebenfalls in die Karten eingetragen. Neben der Reviernummer wurde eine Abkürzung eingetragen, aus der hervorgeht, ob es sich um ein Paar oder um ein einzelnes Männchen gehandelt hat. Gleichzeitige Beobachtungen von Reviernachbarn wurden besonders gekennzeichnet.
Eine Übersicht aller im Rahmen dieser Untersuchung erfaßten Wälder mit Angaben zum Eichenbestand und den Mittelspechtrevieren zeigt die folgende Tabelle:
Legende:
B = Brakeler Bergland; C = Corveyer Forsten;
E = Eggegebirge; FA = Flächenanteil in %
Msp = Mittelspecht; M = Männchen; W = Weibchen;
ST = Steinheimer Wald; (?)= geschätzt
W = Wesertal mit angrenzendem Bergland
| Ort und Gebiets-Nr. | Msp Revier-Nr. | M oder Paar | Größe (in ha) | Alter der Eichen (?) | FA Eiche (?) | Anmerkungen |
| E 3 | - | - | 2 | > 200 | 70 | Eingestreut: Buche, Fichte, Lärche |
| E 4 | - | - | 3 | 160 | 60 | Eingestreut: Buche, Esche |
| E 5 | 1 | Paar | 15 | 200 | 90 | Eingestreut: Buche, Esche |
| E 6 | - | - | 20 | 180 | 60 | Eingestreut: Buche |
| E 7 | - | - | 19 | 150 | 40 | Rest Buche |
| E 8 | - | - | 4 | 80 | 90 | Rest Buche |
| E 9 | 29, 30 | Paar | 11 | 120 | 60 | Rest Buche, vereinzelt Esche |
| E 10 | - | - | 14 | 160 | 40 | Vermischt mit Buche, Lärche, Fichte |
| E 11 | - | - | 2 | 150 | 90 | Rest Buche |
| E 12 | 2,3,4,5 | Paare | 19 | > 200 | 65 | Rest Buche, Esche, Lärche, Fichte |
| E 13 | - | - | 12 | 160 – 200 | 80 | Rest Buche, Esche |
| E 14 | - | - | 6 | 160 | 70 | Rest Buche, Esche, Erle |
| E 15 | 6 | Paar | 7 | 120 | 40 | Rest Buche |
| E 16 | 7 | Paar | 9 | 180 | 60 | Rest Buche |
| E 17 | 8 | Paar | 2 | 200 | 50 | Rest Buche, Lärche, Fichte, Hainbuche |
| E 18 | 9, 10 | Paare | 10 | > 200 | 75 | Rest Buche, vereinzelt Lärche u. Hainbuche |
| E 19 | - | - | 1 | 120 | 80 | Rest Buche, lockerer Bestand |
| E 20 | 24, 25 | Paare | 4 | > 200 | 60 | Rest Buche, Hainbuche, Birke |
| E 21 | 14, 15 | Paare | 9 | 200 | 80 | Rest Buche |
| E 22 | 11 | Paar | 8 | 160 | 60 | Rest Buche |
| E 23 | - | - | 3 | 160 | 40 | Rest Buche, Esche, vereinzelt Hainbuche |
| E 24 | 12, 13 | Paare | 9 | 200 | 100 | Kein Unterholz, Wildschweingehege |
| E 25 | - | - | 1 | 100 | 90 | Rest Esche und Buche |
| E 26 | 16, 17 | Paare | 7 | 180 | 50 | Rest Buchenunterwuchs |
| E 27 | 18, 19, 20 | Paare | 14 | 180 | 80 | Rest Buche, vereinzelt Hainbuche |
| E 28 | 21 | Paar | 7 | 100 | 90 | Rest Buche, einzelne Alteichen 200 Jahre |
| E 29 | 22 | M | 1 | 150 | 40 | Rest Altbuchen |
| E 30 | - | - | 2 | 120 | 80 | Rest Buchen und Lärchen |
| E 31 | 23 | Paar | 1 | 160 | 50 | Rest Buchen |
| E 32 | - | - | 1 | 120 | 70 | Rest Buchen |
| E 33 | 26 | Paar | 4 | 160 | 70 | Rest Buchen, Eschen, Erlen, Pappeln |
| E 34 | - | - | 9 | 120 – 180 | 60 | Rest Buchen, Eschen, Fichten |
| B 1 | 27, 28 | Paare | 16 | 160 | 60 | Rest Buchen, Eschen |
| B 2 | 61 | Paar | 22 | 180 | 50 | Rest Buche, Lärche, Fichte |
| B 3 | - | - | 15 | 130 | 50 | Rest Buche, Hainbuche, Lärche |
| B 4 | - | - | 4 | 150 | 50 | Rest Buche, vereinzelt Fichte |
| B 5 | - | - | 3 | 120 | 70 | Rest Buche, Hainbuche, Esche, Erle |
| B 6 | - | - | 11 | 200 | 80 | Rest Buche |
| B 7 | - | - | 4 | 160 | 60 | Rest Buche, Fichte |
| B 8 | - | - | 1 | 100 | 40 | Rest Buche, kein Unterholz |
| B 9 | 58 | Paar | 6 | 160 | 70 | Rest Buche, Hainbuche |
| B 10 | 59 | Paar | 4 | 180 | 40 | Rest Buche |
| B 11 | - | - | 6 | 150 | 80 | Rest Buche, vereinzelt Lärche |
| B 12 | 57 | Paar | 11 | 160 | 80 | Rest Buche |
| B 13 | - | - | 17 | 120 | 60 | Rest Buche, Esche, Fichte |
| B 14 | 56 | Paar | 5 | > 200 | 60 | Rest Buche, vereinzelt Hainbuche, Fichte |
| B 15 | 40 | Paar | 2 | 180 | 70 | Rest Buche, vereinzelt Bergahorn, Ulme |
| C 1 | 41 | Paar | 3 | 100 | 80 | Rest Buche, Esche, einzelne Alteichen |
| C 2 | 42-44 | Paare | 15 | 180 - 200 | 75 | Rest Buche, vereinzelt Fichte |
| C 3 | 45 | Paar | 1 | 200 | 90 | Einige Buchen und Fichten |
| C 4 | 46-50 | Paare | 31 | 160 – 200 | 70 | Rest Buchen, wenige Fichten |
| C 5 | 54, 55 | Paare | 11 | 160 | 70 | Rest Buche |
| C 6 | 51, 52 | Paare | 15 | 200 –300 | 60 – 80 | Rest Buche |
| C 7 | 53 | M | 3 | 180 | 60 | Rest Buche |
| ST 1 | 31-39 | Paare | 84 | 160 – 200 | 50 | Rest Buche, Fichte, Kiefer, Pappel, Lärche |
| W 1 | - | - | 2 | 100 | 50 | Rest Buche |
| W 2 | - | - | 2 | 100 | 50 | Rest Buche, Pappel, Ahorn |
| W 3 | - | - | 14 | 160 | 40 | Rest Buche, einzelne Eschen, Fichten |
| W 4 | - | - | 5 | 160 | 40 | Rest Buche, einzelne Lärchen, Kiefern |
| W 5 | - | - | 3 | 100 | 50 | Rest Buche |
| W 6 | - | - | 9 | 160 | 40 | Rest Buche, Weichhölzer |
| W 7 | 60 | Paar | 7 | > 200 | 40 | Rest Buche, Weichhölzer, Klippen |
| Summe | 61 Paare | 577 ha |
5.1 Siedlungsdichte
Um die Angaben zur Häufigkeit des Mittelspechtes in den untersuchten Gebieten mit denen anderer Untersuchungen vergleichen zu können, muß man die Siedlungsdichte ermitteln. Dazu berechnet man gewöhnlich, wieviel Reviere auf 10 ha entfallen.
Da der Mittelspecht als “Suchspecht” spezielle Ansprüche an die Beschaffenheit seiner Nahrungs- und Brutbäume stellt, dienten als Berechnungsgrundlage nur über 80-jährige Eichenbestände mit Eichenanteilen von mehr als 40 %, gleichgültig, ob sie besiedelt waren oder nicht. Bezogen auf die gesamte Waldfläche des Kreises Höxter würde eine derartig Berechnung aufgrund des geringen Eichenanteils zu gewaltigen Verzerrungen mit unrealistischen Ergebnissen führen. Eine Vergleichbarkeit mit anderen Untersuchungen wäre dann nicht mehr ohne weiteres gegeben.
| Gebiet | Fläche mit Eichen | Zahl der Reviere | Reviere/10 ha |
| Eggegebirge (E) | 238 | 28 | 1,18 |
| Brakeler Berland (B) | 127 | 8 | 0,63 |
| Corveyer Forst (C) | 86 | 15 | 1,74 |
| Steinheimer Wald (ST) | 84 | 9 | 1,07 |
| Wesertal (W) | 42 | 1 | 0,24 |
Das Eggegebirge ist mit 1,18 Revieren/ 10 ha gut besiedelt, obwohl es klimatisch und von der Höhenlage (meistens zwischen 300 und 400 m ) sicher nicht das Optimum für den Mittelspecht bietet. Andererseits sind die Eichenbestände in dem geschlossenen Waldgebiet weit verteilt. Die angrenzenden Buchen- und Fichtenwälder werden als Nahrungsreviere mitbenutzt, wie mehrere Beobachtungen ergaben.
Das Brakeler Bergland ist sowohl klimatisch als auch von der Höhenlage (100 bis 300 m) besser für den Mittelspecht geeignet. Trotzdem ist die Siedlungsdichte mit 0,63 Paaren/10 ha ziemlich gering. Wie aus Tabelle 2 zu ersehen ist, sind zahlreiche potentielle Reviere trotz nach menschlichem Ermessen optimalen Biotopstrukturen nicht besetzt. Ursache könnte die isolierte Lage zahlreicher Eichenwälder sein. Sie sind auch oft nicht in andere Wälder eingebettet, sondern stehen fernab in großen, rein landwirtschaftlich genutzten Räumen. Die Mittelspechte müßten größere Freiflächen überqueren, um sie zu erreichen, was sie offenbar nicht in jedem Jahr versuchen.
Der Corveyer Forst weist mit Abstand die höchste Siedlungsdichte im Kreis Höxter auf. Das könnte daran liegen, daß hier die meisten alten Eichen mit einem hohen Totholzanteil stehen. Die meisten Eichenabteilungen findet man entlang von Bach- und Trockentälern. Ihre linienhafte Ausdehnung ist groß, während die Breite oft nicht so mächtig ist. Die Talhänge und Berggipfel sind dagegen mit Buchen bestanden. Die flächenhaften Eichenwaldbereiche sind offenbar dichter besiedelt, weil viele Nahrungsreviere auch außerhalb liegen.
Der Steinheimer Wald ist gut besiedelt. Er entspricht in seiner Struktur den Südlippischen Wäldern, die sich im Norden, am anderen Ufer der Emmer, an den Steinheimer Wald anschließen.
Das Wesertal mit seinen unmittelbar angrenzenden Berghängen ist überraschend schlecht besiedelt. Höhenmäßig und klimatisch herrschen hier die besten Bedingungen für den Mittelspecht im Kreis Höxter. Leider kann er sie nicht ausnutzen, da die Eichenwälder an Fläche und Zahl nur sehr gering vertreten sind. Außerdem weisen sie keine optimalen Strukturen auf und liegen entfernungsmäßig weit auseinander.
Siedlungsdichteangaben in der Literatur weisen naturgemäß eine hohe Schwankungsbreite auf, da sie aus den verschiedensten Regionen und Ländern stammen und mit sehr unterschiedlicher Methodik ermittelt wurden. GLUTZ VON BLOTZHEIM & BAUER (1980) geben Werte zwischen 0,3 und 2,4 Brutpaaren/10 ha an. FLADE & MIECH (1986) ermittelten für den Wolfsburger Raum bis zu 3,5 Revieren/10 ha. PÜCHEL (1996) errechnete für den südlichen Kreis Lippe eine durchschnittliche Dichte von 1,38 Paaren/10 ha. Das deckt sich ziemlich gut mit den Werten aus dem Kreis Höxter (durchschnittlich 0,97 Paaren / 10 ha). Beide Werte wären fast identisch, läge nicht im Kreis Höxter ein Ausreißer nach unten (Wesertal) und im Kreis Lippe einer nach oben (Nessenberg) vor.
Die Vermutung PÜCHELS (1996), der die in der Literatur angegebenen Werte als zu niedrig vermutet, kann aufgrund eigener Beobachtungen im Kreis Höxter bestätigt werden.
5.2 Beschreibung der Reviere in den Untersuchungsgebieten
Im folgenden werden weitere Angaben zu den Revieren in den einzelnen Naturräumen gemacht. Es wird nicht jedes einzelne Revier, bzw. jeder einzelne Eichenwald bis ins letzte detailliert beschrieben, weil, um ganz genaue Daten zu erhalten, jede Revierförsterei hätte aufgesucht werden müssen, was den zeitlichen Rahmen für die Untersuchung gesprengt hätte und außerdem eine Beschreibungsgenauigkeit bis ins letzte Detail gar nicht notwendig ist. Es sollen vielmehr Gemeinsamkeiten und Unterschiede herausgestellt werden, die eventuell Schlüsse auf die Besiedlung oder Nichtbesiedlung zulassen, da zu vermuten ist, daß die Mittelspechte, wie andere Vögel auch, ein eher grobes und einfaches instinktives Muster besitzen, mit dem sie ihre Optimalhabitate finden.
5.2.1 Eggegebirge 5.2.2 Brakeler Bergland 5.2.3 Corveyer Forst 5.2.4 Steinheimer Wald 5.2.5 Wesertal und angrenzendes Bergland
5.2.1 Eggegebirge
Die Fläche E 1 befindet sich an der tiefsten Stelle eines Trockentales, ist von Buchenhochwald umgeben und wird von einer Landstraße begrenzt. Die sehr hochstämmigen Eichen weisen fast kein Totholz auf. Außerdem befindet sich dieses Revier 8 km (Externsteine), bzw. 10 km (Steinheimer Wald) von den nächsten besetzten Mittelspechtrevieren entfernt. In Verbindung mit der geringen Größe von nur 2 ha ist dies wahrscheinlich der Grund, daß es nicht besetzt war.
Die Flächen E 2 und E 3 sind mit ihrem alten Eichenbestand nach menschlichem Ermessen die idealen Mittelspechtreviere. Sie grenzen an eine wirtschaftlich nicht genutzte Waldwiese, werden von kleine Bächen mit entsprechender Kraut- und Strauchschicht durchzogen, befinden sich in klimatisch geschützter Lage unterhalb des östlichen Steilabfalls der Egge und sind von altem Buchenwald, verschiedenen Laubmischwäldern und eingestreuten Fichtenabteilungen umgeben. Trotzdem gibt es hier keine Mittelspechte. Ein Grund dafür dürften ebenfalls die großen Entfernungen zu den nächsten besetzten Revieren sein. Eine weitere Ursache dürfte die hohe Siedlungsdichte des Buntspechtes sein. Beim Abspielen der Klangattrappe kam sofort ein schimpfender Buntspecht angeflogen, der erst verschwand, als er den Verursacher der Rufe als Mensch identifizierte. Bei entsprechend geringem Angebot an Nistbäumen scheint der Buntspecht den Mittelspecht als schwächeren Konkurrenten zu vertreiben (siehe auch Steinheimer Wald ST 1).
Die Fläche E 4 ist ebenfalls relativ klein und liegt sehr isoliert am Fuß des Eggehanges. Möglicherweise ist hierin die Ursache der Nichtbesiedlung zu suchen.
Die Reviere E 5, E 9 und E 12 weisen viele Gemeinsamkeiten mit den Flächen E 2 und E 3 auf. Abgesehen von E 9 sind die Eichen hier bereits um 200 Jahre alt. Sie befinden sich alle in Hanglagen und werden von Bächen durchzogen. In unmittelbarer Bachnähe befinden sich, vermutlich wegen des tiefgründigeren Bodens, die Zentren der Mittelspechtreviere. Diese Beobachtung gilt auch für fast alle anderen besetzten Reviere, die von Bächen durchzogen werden. Erstaunlich ist die hohe Mittelspechtdichte in E 12. An einem eingestreuten Fichtenabschnitt konnte die Stelle ermittelt werden, an der drei Mittelspechtreviere aneinandergrenzten. Durch gleichzeitige Beobachtung mit zwei Personen konnte ausgeschlossen werden, daß hier eine Doppelzählung erfolgte.
In der Fläche E 6 stehen die Eichen entlang eines nur periodisch fließenden Baches in einem Buchenwaldgebiet. Die Form des Reviers ist entsprechend lang, aber schmal. Ob das der Grund für die Nichtbesiedlung ist, kann nicht gesagt werden, da im Brakeler Wald eine Fläche mit ähnlicher Form und gleichen Strukturen (B 10) von einem Paar besiedelt ist. Die Krautschicht ist ausgeprägt, die Strauchschicht spärlich.
Die Fläche E 7 ist zwar recht groß. Der flächenmäßige Anteil der Eiche jedoch mit höchstens 40% gering. Die Eichen stehen in enger Konkurrenz mit der Buche. Sie sind entsprechend hochstämmig und unterhalb der Kronen weitgehend astlos. Es gibt kaum Totholz zum Höhlenbau. Die Totholzanteile in der Buche werden weitgehend vom Buntspecht genutzt (bis zu 9 Höhlen in einem Baum).
In der Fläche E 8 sind die Eichen mit 80 Jahren und ziemlich gleichmäßiger Struktur offenbar noch zu jung.
In der Fläche E 10 sind die Eichen zwar älter, sie sind jedoch im Gesamtbestand so verteilt, daß sie wie Einzelbäume wirken und keine geschlossenen Abteilungen bilden. Es konnten keine Mittelspechte nachgewiesen werden.
E 11 ist offenbar mit max. 1 ha zu klein. Zwar wurden durchaus ähnlich kleine Eichenwälder gefunden, die besetzt waren (z.B. E 29 und E 31), aber die befanden sich in der Nähe weiterer gut besetzter Reviere.
Bei den Flächen E 13 und E 14 handelt es sich um optimale ältere Eichenwälder im staunassen Bereich des östlichen Eggelängstales. Beide Flächen wurden mehrfach mit negativem Ergebnis kontrolliert. Als Grund für die Nichtbesiedlung könnten hier wieder die Entfernung zur nächsten Mittelspechtpopulation und eventuell die längeren Grenzlinien zum Grünland vermutet werden.
Die Fläche E 15 enthält nur einen geringen Eichenanteil, der noch dazu kaum Totholz aufweist. Die Bruthöhle befand sich in einer Altbuche. Das Nahrungsrevier lag zum Teil in einer größeren Fichtendickung. Hierhin wurden auch die flüggen Jungen geführt, wo sie bei der Fütterung fotografiert werden konnten.
Bei den Flächen E 16, E 17, E 21, E 22, E 24, E 26, E 27 und E 28 handelt es sich um relativ gleichartige, ältere Eichenbestände mit mehr oder weniger eingestreuten Buchen und geringer Strauchschicht. Alle Flächen sind in ähnlicher Dichte vom Mittelspecht besetzt. Der Kronenbereich ist ziemlich dicht. Die Eichen weisen zahlreiche abgestorbene Seitenäste auf, in denen sich die gefundenen Bruthöhlen befinden. Alle Flächen befinden sich auf Kuppen oder Hängen und sind relativ trocken.
Von ähnlicher Struktur ist die Fläche E 18. Der südliche Teil dieser Fläche weist jedoch durch Rodung nur einen sehr lückigen Eichenbestand auf. Die zuvor kahlen Stämme sind zum Teil wieder dicht begrünt, tote Seitenäste längst abgefallen. Unter diesen Eichen befindet sich mannshoher dichter Unterwuchs aus Buche und Esche. Hier konnten trotz intensiver Suche keine Mittelspechte festgestellt werden. Die Brutreviere der beiden Paare lagen im nördlichen “normal dichten” Bereich. Die Spechte konnten auch mittels Klangattrappe nicht in den offenen, lückigen Bereich gelockt werden.
Die Fläche E 19 wies wegen Holzeinschlag eine ähnliche Struktur auf wie der südliche Teil der Fläche E 18. Auch hier konnten keine Mittelspechte ermittelt werden.
Die Fläche E 20 ist seit mehreren Jahrzehnten Naturschutzgebiet. Die Alteichen befinden sich hier in einem Talkessel mit Quellmulde und Bach. Das ganze Gebiet weist Urwaldcharakter auf. Auch hier stehen die Eichen sehr locker. Im Gegensatz zu den vorgenannten Flächen ist das aber schon mindestens seit 2 Jahrhunderten so. Die Bäume haben entsprechend wuchtige Kronen mit dicken Seitenästen ausgebildet. Der Anteil an toten Ästen und ganzen Bäumen ist sehr hoch. Mit 2 Brutpaaren auf 4 ha erreicht der Mittelspecht hier seine höchste Siedlungsdichte im Kreis Höxter.
In der Fläche E 23 verteilen sich die wenigen Eichen zu sehr auf die Gesamtfläche, so daß nicht der Eindruck eines Eichenwaldes entsteht. Wahrscheinlich ist das der Grund für das Fehlen des Mittelspechtes.
Fläche E 25 ist sehr klein und die Eichen sind zum Teil erst 100 Jahre alt. Sie bieten noch keine Möglichkeiten zur Anlage von Höhlen.
Fläche E 30 wird offenbar vom Paar 23, das in Fläche E 31 anzutreffen ist, als Nahrungsrevier genutzt. Das Überfliegen des Wiesentales, das beide Flächen trennt, konnte mehrfach beobachtet werden.
Fläche E 32 befindet sich in einer Senke inmitten von Buchenwald am Hang zum Diemeltal. Die Strauchschicht fehlt. Eine Krautschicht ist nur gering ausgebildet, der Bestand sehr trocken und von der Fläche her klein.
Fläche E 33 ist in der Struktur mit den Flächen E 9 und E 12 vergleichbar. Es handelt sich hier um einen Eichenbestand an einem Waldbach.
Bei der Fläche E 34 handelt es sich nicht um einen geschlossenen Eichenwald, sondern um Buchenwald, in dem die Eichen mehr oder weniger verteilt wachsen. Daneben kommen noch Pappeln, Edellaubhölzer und Fichten vor. Die Strauchschicht und die Krautschicht sind gut ausgebildet. Trotz guter Brutmöglichkeiten ist diese Fläche nicht vom Mittelspecht besetzt. Offenbar ist die Entfernung zu den nächsten Populationen zu groß.
Beschreibung der Mittelspechtreviere
5.2.2 Brakeler Bergland
Bei der Fläche B 1 handelt es sich um 5 Teilflächen, die durch jüngeren Buchen- bzw. Nadelwald voneinander getrennt sind. Von ihnen sind jedoch nur die beiden größeren vom Mittelspecht besiedelt. Die ältesten Eichen stehen in den tiefstgelegenen Teilen der staunassen Böden, die sehr lange offene Wasserflächen aufweisen. Beide Paare sind räumlich so weit voneinander getrennt, daß sie keinen Kontakt miteinander haben.
Die Fläche B 2 liegt sehr isoliert am Rand des Nethetales. Ihr alter Eichenbestand ist mit zahlreichen Buchen, sowie einzelnen Fichten und Lärchen durchsetzt. Erstaunlicherweise konnte trotz nach menschlichem Ermessen optimalen Bedingungen und mehrfacher Kontrolle nur 1 Paar Mittelspechte nachgewiesen werden. Da dieses Revier mehrere Kilometer vom nächsten entfernt ist, könnte das ein Beweis dafür sein, daß der Mittelspecht außerhalb der Brutzeit auf der Suche nach geeigneten Lebensräumen weit umherstreift und so auch zufällig auf isolierte Eichenwälder stoßen kann, die er zumindest in Jahren höherer Spechtdichte besiedelt.
Von den Flächen B 3 bis B 8 sind die meisten ebenfalls sehr gut geeignet (besonders die Fläche B 6). Allen gemeinsam ist lediglich die isolierte Lage. Die höchst mögliche Dichte an Mittelspechten im Kreis Höxter ist offenbar noch längst nicht erreicht, so daß sich die Wanderungen des Mittelspechtes in Grenzen halten.
Die Flächen B 9, B 12, B 14 und B 15 ähneln sich sehr und weisen keine Besonderheiten auf. Sie liegen auf Bergrücken oder an Hängen und sind entsprechend trocken.
Bei der Fläche B 10 handelt es sich nicht um einen geschlossenen Eichenwald, sondern um einen schmalen Eichenstreifen, der sich inmitten von Buchenwald an einem trockenen Bachlauf entlang zieht. Hier wurde nicht mit dem Vorkommen von Mittelspechten gerechnet.
Die Eichen der Fläche B 13 könnten vom Alter her durchaus besiedelt werden. Die Fläche und die umliegenden Buchenbestände wurden jedoch im Winter durchforstet. Es konnte kein Totholz in den Bäumen entdeckt werden.
Beschreibung der Mittelspechtreviere
5.2.3 Corveyer Forst
Die Flächen C 1 bis C 7 sind pauschal schon hinreichend bei den Angaben zur Siedlungsdichte beschrieben worden. Ihr ist kaum etwas hinzuzufügen. Bemerkenswert ist lediglich, daß sich die staunassen Bereiche hier an den höchsten Punkten (um 270 m ü. NN) befanden.
Beschreibung der Mittelspechtreviere
5.2.4 Steinheimer Wald
Der Steinheimer Wald (Fläche ST 1) ist im Relief und in der Bestockung sehr abwechslungsreich. Berghänge und –rücken wechseln mit Tälern, die teils trocken, teils feucht sind. Der Wald grenzt an die Emmeraue mit umliegenden Feuchtgebieten und an landwirtschaftliche Nutzflächen. Die Brutreviere liegen zwar alle in den Eichenwaldgebieten, die Nahrungsreviere befinden sich teilweise aber außerhalb. Es konnte hier auch wieder Konkurrenz mit dem Buntspecht beobachtet werden. Auf die Rufe der Klangattrappe reagierten in einem Fall ein Buntspecht und ein Mittelspechtpaar durch gleichzeitiges Erscheinen. Der Buntspecht versuchte mehrfach das Mittelspechtpaar zu vertreiben.
Der gute Besatz des Steinheimer Waldes mit Mittelspechten ist sicher auch in der Tatsache begründet, daß sich am nördlichen Emmerufer Teile des südlichen Lippischen Berglandes anschließen, die die Hauptvorkommen des Mittelspechtes in Lippe bilden.
Beschreibung der Mittelspechtreviere
5.2.5 Wesertal und angrenzendes Bergland
Während auf der östlichen Weserseite, im Solling, großflächige alte Eichenbestände zu finden sind, gibt es auf der westlichen Weserseite nur noch geringe Eichenwaldreste. Die vorhandenen Eichen verteilen sich dazu noch in geringer Dichte über größere Buchenwaldflächen, so daß sie schon aus diesem Grund für den Mittelspecht nicht als geeignet erscheinen. Es verwundert daher nicht, daß das einzige Brutpaar in dem ca. 300 Jahre alten Eichenwald innerhalb des Naturschutzgebietes “Hannoversche Klippen” zu finden war.
5.3 Die Biotoppräferenz des Mittelspechtes im Kreis Höxter
Die gesammelten Daten über die Mittelspechtreviere bieten eine ausreichende Basis, um Aussagen zur Biotoppräferenz des Mittelspechtes zu treffen. Ein Vergleich mit den Untersuchungsergebnissen im Kreis Lippe zeigt, daß sich hier so gut wie keine Abweichungen ergeben.
Auch bei uns kommt die Eiche in allen Revieren mindestens mit einem Flächenanteil von 40 % vor. Es handelt sich vorwiegend um die Stieleiche. Es wurde bei den Untersuchungen aber nicht nach Stiel- und Traubeneiche differenziert. Daneben gibt es auch zahlreiche Bestände der Amerikanischen Roteiche und einen Zerreichenwald. Sie sind aber noch zu jung, um für Mittelspechte attraktiv zu sein. Möglicherweise werden auch Roteichenwälder in höherem Alter wegen der glatteren Rinde nicht besiedelt.
Reine Eichenbestände kommen im Kreis Höxter fast nicht vor. Die meisten Flächen sind mehr oder weniger stark mit Rotbuchen durchsetzt. In geringer Flächendichte oder vereinzelt kommen je nach Standort andere Baumarten wie Fichte, Kiefer, Lärche, Hainbuche, Esche, Zitterpappel, Hybridpappel, Erle, Birke und Bergahorn vor.
Auch im Kreis Höxter kann bestätigt werden, daß Eichenwälder erst ab einem Alter von mindestens 100 Jahren besiedelt werden. Stichprobenartig wurden mehrfach auch jüngere Eichenbestände im Alter von 60 bis 90 Jahren, zum Teil mit einzelnen Eichenüberhältern, überprüft, jedoch ohne Ergebnis.
Die folgende Tabelle zeigt die Anzahl der besetzten Mittelspechtreviere in Abhängigkeit zum Alter der Eichenbestände, in denen sie sich befinden. Es zeigt sich deutlich, daß mit zunehmendem Alter der Eichen auch die Anzahl der besetzten Reviere steigt. Die geringere Zahl der Mittelspechtreviere in den Beständen mit einem Alter von über 200 Jahren liegt lediglich daran, daß diese Altersgruppe relativ wenig anzutreffen ist.
| Alter der Eichen in Jahren | Anzahl der besetzten Bestände |
| unter 101 | 2 |
| 101 bis 150 | 4 |
| 151 bis 200 | 43 |
| über 200 | 12 |
|
|
|
| Summe | 61 |
Auch die lippischen Ergebnisse hinsichtlich der Flächengröße der Bestände, daß nämlich isolierte Flächen unter 2,5 ha Größe wahrscheinlich nicht besetzt werden, kann im wesentlichen bestätigt werden. Flächen geringerer Ausdehnung (z.B. E 29 und E 31) liegen in der Nähe weiterer besetzter Reviere.
Über das Fehlen der Art in nach menschlichem Ermessen geeigneten Flächen, z. B. im Brakeler Bergland, lassen sich nur Vermutungen anstellen. Hier wären weitere Untersuchungen über mehrere Jahre nötig, um zu gesicherteren Aussagen zu kommen, da z. B. über Fluktuationen im hiesigen Raum nichts bekannt ist.
6. Zusammenfassung
Im Kreis Höxter wurden im Jahr 1997 61 Mittelspechtreviere nachgewiesen werde. Bis auf wenige Ausnahmen handelte es sich um Brutreviere, da beide Partner beobachtet werden konnten. Die Zahl liegt weit über den in der Literatur publizierten Daten (PREYWISCH, 1961). Da vorher nie eine systematische Erfassung der Art im Kreis stattgefunden hatte, waren genauere Aussagen als die, daß der Mittelspecht selten ist, nicht möglich.
Als unauffällige Art ist der Mittelspecht ohne Einsatz von Klangattrappen nur mit großem Aufwand und auch dann nicht zuverlässig nachweisbar.
Das Verbreitungsbild spiegelt deutlich die Lage der älteren Eichenwälder wieder, wobei allerdings das Innere des Brakeler Berglandes ziemlich unbesetzt ist. Die Ursachen dafür können nur vermutet werden.
Bei entsprechend optimalen Eichenwäldern mit höherem Totholzanteil werden auch höhere Lagen des Eggegebirges besiedelt. Die beiden höchstgelegenen Reviere befinden sich auf dem 372 m hohen Stuckenberg (E 21).
Einige sehr gut geeignete Flächen in der Nordegge (E 2 und E 3) blieben möglicherweise wegen des hohen Konkurrenzdruckes durch den Buntspecht unbesiedelt.
7. Literatur
BAUER, K. und GLUTZ VON BLOTZHEIM, U. (1980): Handbuch der Vögel Mitteleuropas; Akademische Verlagsgesellschaft, Frankfurt am Main
CONRADS, K u. W. (1992): Der Mittelspecht (Picoides medius) im Beller Holz (Kreis Lippe) 33. Bericht des Naturwiss. Vereins für Bielefeld u. Umgebung e.V. über das Jahr 1991
MÜLLER, J. (1989): Brutvogelkartierung des Kreises Höxter 1988 – 1989; Egge – Weser 1989/02, Veröffentlichungen des Naturkundlichen Vereins Egge – Weser, ISBN 0930-293 X
PREYWISCH, K. (1961): Die Vogelwelt des Kreises Höxter; Herausgegeben vom Landkreis Höxter im Verlag Gieseking, Bielefeld
PÜCHEL, F. (1996): Kartierung des Mittelspechtes im Kreis Lippe 1996; unveröff. Manuskript
Anschrift des Verfassers:
Gerhard Steinborn, Im Springe 2a, 37671 Höxter-Bruchhausen,
Tel.: 05275/8661
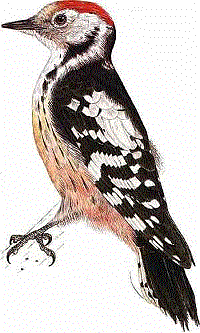 Wichtigste Unterscheidungsmerkmale
gegenüber dem geringfügig größeren Buntspecht sind
der vollständig rote Scheitel (Verwechslungsgefahr mit jungen Buntspechten, die ebenfalls eine
rote Kopfplatte besitzen, die aber schwarz
eingerahmt ist), helle Kopfseiten, Brust- und
Bauchseiten dunkel längsgestrichelt,
Unterschwanzdecken und Bauch rosa statt rot.
Wichtigste Unterscheidungsmerkmale
gegenüber dem geringfügig größeren Buntspecht sind
der vollständig rote Scheitel (Verwechslungsgefahr mit jungen Buntspechten, die ebenfalls eine
rote Kopfplatte besitzen, die aber schwarz
eingerahmt ist), helle Kopfseiten, Brust- und
Bauchseiten dunkel längsgestrichelt,
Unterschwanzdecken und Bauch rosa statt rot.