Die Amphibien im Kreis Höxter
3.7 Gelbbauchunke - Bombina variegata (LINNAEUS,1758)
 Neben der Geburtshelferkröte ist die Gelbbauchunke der
einzige einheimische Vertreter der Scheibenzüngler. Bei dieser recht
ursprünglichen Amphibiengruppe ist die Zunge von scheibenförmiger Gestalt und
bis auf einen schmalen Rand in ihrer ganzen Breite am Mundboden festgewachsen.
Sie kann somit nicht herausgeklappt werden.
Neben der Geburtshelferkröte ist die Gelbbauchunke der
einzige einheimische Vertreter der Scheibenzüngler. Bei dieser recht
ursprünglichen Amphibiengruppe ist die Zunge von scheibenförmiger Gestalt und
bis auf einen schmalen Rand in ihrer ganzen Breite am Mundboden festgewachsen.
Sie kann somit nicht herausgeklappt werden.
Charakteristisch für die Gelbbauchunke ist die gelbe
Bauchseite, die zahlreiche graublaue bis schwarze Flecken aufweist.
Während die Männchen der Frösche und Kröten die Weibchen
bei der Paarung hinter den Vorderbeinen umklammern, ergreifen die Männchen der
Scheibenzüngler ihre Weibchen in der Lendengegend. Wie die Geburtshelferkröte
können sich die Tiere mehrmals im Jahr verpaaren und setzen dabei jeweils nur
wenige Eier ab.
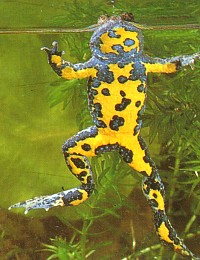 Die Gelbbauchunke ist ganzjährig an Gewässer gebunden,
zeigt aber keine Laichplatztreue. Sie entfernt sich öfter vom Wohn- und
Laichgewässer und wandert, besonders bei Regenfällen, auch größere Strecken
über Land, wobei neue Lebensräume erschlossen werden.
Die Gelbbauchunke ist ganzjährig an Gewässer gebunden,
zeigt aber keine Laichplatztreue. Sie entfernt sich öfter vom Wohn- und
Laichgewässer und wandert, besonders bei Regenfällen, auch größere Strecken
über Land, wobei neue Lebensräume erschlossen werden.
Als Laichgewässer bevorzugt die Gelbbauchunke besonnte,
meist vegetationsarme Klein- und Kleinstgewässer, die normalerweise eine dünne
Schicht von leicht „verwirbelbarem" Bodenschlamm aufweisen (BLAB 1986).
In diesen graben sich die Tiere bei der Flucht vorübergehend ein. Die
Wasserführung dieser oft pfützenartigen Gewässer ist relativ sicher. Sie
trocknen im Vergleich zu den ähnlich kleinen Laichgewässern der Kreuzkröte
wesentlich seltener aus.
Die ursprünglichen Lebensräume dieser Art liegen im Bereich
natürlicher Fließgewässer, die nicht verbaut sind (NÖLLERT & GÜNTHER
1996).
Hier entstehen besonders im Bergland nach Hochwässern
während der Schneeschmelze immer wieder vegetationsarme, flache und sich daher
schnell erwärmende Kleingewässer, die als Laichhabitat bevorzugt werden.
Die Gelbbauchunke, auch Bergunke genannt, ist ein typischer
Bewohner des Hügel- und Berglandes, wo sie bis in Höhen von 500 m ü. NN,
selten noch höher, anzutreffen ist.
Das Verbreitungsgebiet umfasst Mittel- und Südeuropa. Im
Westen liegt die Verbreitungsgrenze in der Nähe der französischen
Atlantikküste, im Norden im Weserbergland und im Harz. Östlich reicht ihr
Verbreitungsgebiet fast bis zum Schwarzen Meer. Als Art, die im Anhang II der
FFH-Richtlinie der EU geführt wird, ist ihr Schutz von gesamteuropäischem
Interesse.
Nach WOLTERSTORFF (1893) soll die Gelbbauchunke Ende des 19.
Jahrhunderts im Weserbergland weit verbreitet gewesen sein. Aus dem Kreis nennt
er Vorkommen bei Haarbrück und aus der Gegend um Steinheim. Heute ist die Art
im Kreis Höxter ausgestorben.
Ein Blick auf die Verbreitungskarte zeigt, daß der
Steinheimer Raum bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts einen
Verbreitungsschwerpunkt für diese Art dargestellt hat. Alle anderen gesicherten
Nachweise sind im Kreis weitgestreut und dürften bereits zu jener Zeit keinen
Kontakt untereinander mehr gehabt haben. Zum Zeitpunkt der ersten systematischen
Erfassung durch PREYWISCH wiesen die meisten Vorkommen nur noch wenige
Individuen auf, lediglich in den Nieheimer Tongruben war noch eine größere
Population anzutreffen: DORNENWERTH gibt für 1967/68 die Zahl der rufenden
Tiere mit mindestens 150 an! Bereits 10 Jahre später konnten hier nur noch
einzelne Tiere nachgewiesen werden. Nach 1978 wurden aus dem Kreis keine
aktuellen Vorkommen mehr bekannt.
Als typische Pionierart besiedelte die Gelbbauchunke
hauptsächlich (ca. 62 %) frühe Stadien von Kleingewässern, die beim
Bodenabbau (v.a. Mergel und Ton) oder durch Erdfälle (Dolinen) entstanden sind.
Nach NÖLLERT & NÖLLERT (1992) ist die Präferenz für diese Lebensräume
in ganz Mitteleuropa festzustellen. Drei Populationen (= 23 %) nutzten kleine
Tümpel als Laichgewässer. Lediglich zwei Nachweise beziehen sich auf größere
Teiche. Weitere drei Hinweise beziehen sich ebenfalls auf Teiche, sind aber
unsicher. Überlässt man die von den Unken bevorzugten Kleingewässer sich
selbst, werden sie wegen der fortschreitenden Sukzession für die Tiere bald
unattraktiv. Als Pflegemaßnahmen müssen entweder ständig neue Kleingewässer
geschaffen oder die bestehenden auf ein früheres Stadium der Sukzession zurück
versetzt werden. Im Kreis Höxter wurde dieses leider versäumt, so daß selbst
die große Population in Nieheim innerhalb weniger Jahre zum Aussterben
verurteilt war.
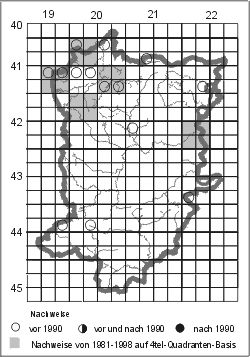 Bekannte Vorkommen im Kreis Höxter und der direkten
Nachbarschaft:
Bekannte Vorkommen im Kreis Höxter und der direkten
Nachbarschaft:
4119/4 : bei Feldrom, 1893, (Westhoff)
4119/4 : Gelbbauchunken über dem ehemaligen Gipswerk verhört, 1963,
(Voss)
4119/4 : Dolinen bei Vinsebeck, 1973, (Holste), 1976, (Luce)
4120/1 : Gelbbauchunken nahe Tümpel am Norderteich, ca. 1965, (Wolff);
am oberen Kohlenberg am Weg nach Wehren, 1948, (Wolff); zwei Nachweise in
Tümpeln in Mergelkuhlen, 1972, (Goethe); Nachweis aus Billerbeck am Rande
von Simonsmeyers Holz, 1948, (v. Ohlen)
4120/2 : Gelbbauchunken in mehreren Tümpeln an der Station in Steinheim,
1893, (Henneberg, zit. in WOLTERSTORFF)
4120/3 : Waldrand bei Steinbruch Ottolien, 1980, 2 Expl. in Pfützen
(Struck)
4120/4 : Ziegelei Nieheim, 1967/68, mindestens 150 rufende Tiere,
hauptsächlich Grube Rath (Dornenwerth); 1972, 2 Rufer Grube Lücking, ?
Rufer Grube Rath, 1975, 6 Tiere in Grube Lücking, 1978, 8 Tiere in Pfütze
Grube Lücking, 1.7.75 in Rath ein Trupp, bei Lücking einzelne (viele
gesehen!), 1977 ein Tier in Rinne Lücking (Preywisch)
4121/1 : Kollerbeck, Mühlenteich im Dorf, 6.5.71, (Preywisch zitiert
Anwohner: „Unken rufen am Entenhäuschen") unsichere Angabe
4121/2 : Bönekenberg bei Papenhöfen, Fischteiche Meier, 1971 (Preywisch
zitiert Meyer sen.: „Unken rufen") unsichere Angabe
4121/4 : Fischteiche Meinte bei Fürstenau, 1972, einige Unken verhört?
(Preywisch), unsichere Angabe
4122/3 : Albaxen, Tongrube an der Thonenburg, 1970, (n.
Rühmekorf)
4221/3 : Brakel, Mergelgrube am Kaiserbrunnen, 1965, (Stephan lt.
Preywisch)
4222/2 : Neuhaus, in den neuen Teichen a.d. Kegelbahn vorm Ort, 1982, 1
Jungtier (lt. Tschapke, 20.8.82)
4321/2 : Drenke, Feuerlöschteich, 1971, (Pfarrer Heining lt. Preywisch:
„an warmen Maiabenden rufen in den Teichmauern die `Unken`".),
Verwechslung mit Geburtshelferkröte?
4322/3 : Tümpel bei Haarbrück, ziemlich häufig, 1893 (Wolterstorff)
4419/2 : Hardehausen, ehemalige Forellenteiche bei Oberförsterei, 1960
und 1962 je ein Tier, seither nicht mehr (Weimann)
4420/1 : Bonenburg, Tongrube südlich, 1962, (Weimann)
 Neben der Geburtshelferkröte ist die Gelbbauchunke der
einzige einheimische Vertreter der Scheibenzüngler. Bei dieser recht
ursprünglichen Amphibiengruppe ist die Zunge von scheibenförmiger Gestalt und
bis auf einen schmalen Rand in ihrer ganzen Breite am Mundboden festgewachsen.
Sie kann somit nicht herausgeklappt werden.
Neben der Geburtshelferkröte ist die Gelbbauchunke der
einzige einheimische Vertreter der Scheibenzüngler. Bei dieser recht
ursprünglichen Amphibiengruppe ist die Zunge von scheibenförmiger Gestalt und
bis auf einen schmalen Rand in ihrer ganzen Breite am Mundboden festgewachsen.
Sie kann somit nicht herausgeklappt werden.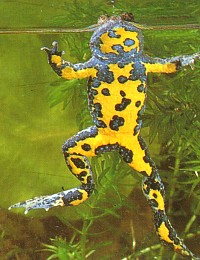 Die Gelbbauchunke ist ganzjährig an Gewässer gebunden,
zeigt aber keine Laichplatztreue. Sie entfernt sich öfter vom Wohn- und
Laichgewässer und wandert, besonders bei Regenfällen, auch größere Strecken
über Land, wobei neue Lebensräume erschlossen werden.
Die Gelbbauchunke ist ganzjährig an Gewässer gebunden,
zeigt aber keine Laichplatztreue. Sie entfernt sich öfter vom Wohn- und
Laichgewässer und wandert, besonders bei Regenfällen, auch größere Strecken
über Land, wobei neue Lebensräume erschlossen werden.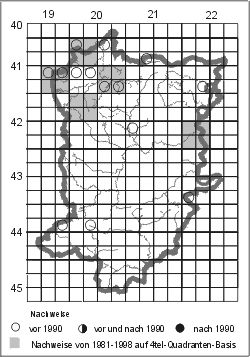 Bekannte Vorkommen im Kreis Höxter und der direkten
Nachbarschaft:
Bekannte Vorkommen im Kreis Höxter und der direkten
Nachbarschaft: